


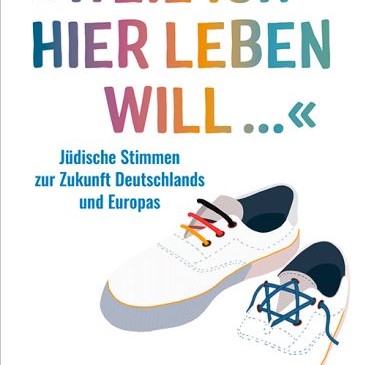
Am Ende einer Flucht landete Großvater Mischa in Ivankiv, wo einmal „ein florierendes Schtetl gewesen“ sein soll, „noch dazu mit einem riesigen jüdischen Friedhof“.
So vage schwebt die Formulierung über der Topografie von etwas Unauffindbarem.
Manchmal ist ein Gedächtnis das einzige Archiv. Die Erinnerungen einer Greisin liefern Olga Osadtschy Informationen aus einer Zeit jüdischen Lebens in einer ukrainischen Kleinstadt, das in einem Pogrom so gründlich endete, dass der Großvater der Erzählerin an Ort und Stelle davon schon nichts mehr vorfand. Die Zeichen waren zerstört worden.
Nun gräbt sie Osadtschy aus dem Gedächtnis der Greisin.
„Dort, wo sich einst der jüdische Friedhof befunden hatte, war jetzt ein eingezäuntes, leeres (vormals auch als Müllkippe genutztes) Grundstück.“
„Weil ich hier leben will - Jüdische Stimmen zur Zukunft Deutschlands und Europas“, herausgegeben von Walter Homolka, Jo Frank, Jonas Fegert, Herder Verlag, 224 Seiten, 20,-
Osadtschys Spurensuche verfolgt ein akademisches und ein biografisches Ziel. Bis sie als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, war ihre jüdische Herkunft nicht viel mehr als eine Chimäre. Man brachte ihr in der geistigen Umgebung des Aussiedlerheims das Judentum näher in Konkurrenz mit dem Herrschaftstext der aufnehmenden Gesellschaft. Davon berichtet Osadtschy in dem Beitrag „Wie ich in einen Bus stieg und Jüdin wurde.“
Cecilia und Yair Haendler äußern sich nach Osadtschy in einem „Zwiegespräch“ – „Berliner Juden“. Sie sagen: „Das neue Judentum schaut immer zurück“, jedoch so paradox wie Paul Klees von Walter Benjamin als Sinnbild in die Pflicht genommener Angelus Novus zurück in die Zukunft schaut. Berlin ist für das Paar „ein ziemlich neuer jüdischer Planet“, ausgenommen von der „religiösen, identitären, lebendigen Kontinuität“, die sich weltweit in anderen Städten beobachten lässt. Trotzdem sieht es für eine kosmopolitische Jeunesse dorée so aus, als sei jewishing in Berlin auf dem Stand des letzten Schreis von New York.
Man hat so viel zur Verfügung auf den Stationen der Zerstreuung. Vom polnischen Geburtsort der Großeltern über einen Diaspora-Stopover in Marrakesch bis nach Marzahn gibt es kaum Unterbrechungen der kulturellen Magistrale, die auch als Partymeile funktioniert.
„Der Schabbat endete spät. Wir trafen uns in einem Café, aus dem wir später rausgeschmissen wurden, weil wir zu laut waren. Wir liefen die ganze Nacht durch die schlafende Stadt.“
Am Morgen hat jeder seinen Flug nach Paris, der nicht gerade in Berlin seine Spannweite testet.
Postsowjetische „Kontingentjuden“ und Israelis, die sich temporär für Berlin entscheiden, liefern dem Diskurs Szenen und Farben. Kaum einer ignoriert Max Czollek, fast alle postulieren ein autonomes „Wir“.
Da er von Czollek auch in dieser Sammlung auf den Punkt gebracht wird, hier noch mal der Debattenhochpunkt:
Das Paradigma der Dominanzkultur aka Mehrheitsgesellschaft gründet auf dem „trügerischen Selbstbild“ vom geläuterten Deutschen und verzeihenden Juden. Man hat sich selbst begnadigt und den Opfern ihre Rollen im „Gedächtnistheater“ (Y. Michal Bodemann) vorgeschrieben. Das Zauberwort lautet Normalität. Die Deutschen haben sich eine neue Normalität herbei phantasiert. Das Phantasma erlaubt es, die Opfer auf dem Altar der Selbstgerechtigkeit weiter zu opfern – sie zu funktionalisieren.
Czollek erweitert das Spektrum mit dem Begriff Des-Integration. „Des-integriert euch“ ist keine artistische Avantgarde-Formel, sondern eine politische Forderung und ein aktivistisches Konzept. Den Verfechtern einer vielfältigen Gesellschaft liefert das Konzept Argumente für „unversöhnliche Interventionen“. Es postuliert eine Opposition, die über die Kulturufer tritt und aus den Theatern in den politischen Raum vorstößt, um da Nazis Einhalt zu gebieten.
Die Anthologie-Autoren bewegen sich weitgehend in dem von Czollek abgesteckten Rahmen. Ihre Texte atmen den Czollekgeist einer zur offensiven Teilhabe entschlossenen Generation, die ihren „in der Luft wurzelnden Eltern“ in keine defensive Nische folgen will.
Die in der Gegend von Haifa auf die Welt gekommene Meytal Rozental stellt fest, dass ihre Familiengeschichte ein Massengrab der fehlenden privaten Bezüge ist.
„Die Geschichten meiner Vorfahren sind mit ihnen (im Holocaust) gestorben.“
Rozental lebt in Neukölln. Nach Berlin kam sie aus Jerusalem: eine Stadt, die ihr „zu anstrengend, zu angespannt, zu segregiert“ erscheint.
Aus dem Rahmen fällt Yan Wissmann, für den ich noch einmal auf Benjamin zurückkomme. Die politische Utopie der säkularisierten Über- und Gründerväter der Benjamin-Generation, die gewiss ein jüdisch-christliches Abendland vor Augen hatten und danach trachteten, dem wilhelminischen Deutschland ihre Bürgerlichkeit zu beweisen, lösten bereits bei ihren Söhnen ein Unbehagen vor der Assimilation aus.
Wissmann kehrt gedanklich bei den Altvorderen ein.
„Die Reform und Anpassung an die Moderne geschah insbesondere in Deutschland.“
Strategische Identitätspolitik
Danach fordert Hannah Peaceman mehr Streitbarkeit im Namen pharisäischer Schulleiter, die einst der Demokratie den Weg durch die Moore der Uneinigkeit wiesen. Sie feiert den Dissens als Potenz.
„In der Diversität der jüdischen Gemeinschaft steckt ein großes Potential für Machloket.“ (Mein deutsches Rechtschreibprogramm erkennt Machloket genauso wie Merhamet als fehlerfrei geschriebene Wörter an.)
Auf der Suche „nach neuen Allianzen“ tritt Tobias Herzberg ermahnend auf. „Macht es euch nicht zu einfach“, verlangt er von dem „Wir“ der normativ Inkonsistenten, die alles Mögliche sein können, nur keine „normalen Menschen“. Mehrheiten organisieren sich, so Herzberg, grammatisch mit dem generischen Maskulinum nicht zuletzt. Der Autor unterscheidet zwischen den „unmarkierten Positionen“, die dem weißen Mann selbstverständlich zukommen, als würde arm, blöd, schlecht angezogen, krank, stinkend, klein, schwach, ängstlich, alt, schniefend sich in einem Transformator der unmarkierten Positionen automatisch ins Gegenteil verwandeln. Aber gut. Wahr bleibt, du kannst deine Kippa in einer Kippe verstauen, während eine person of colour immer Gesicht zeigen muss.
Daran gewöhnt man sich.
Herzberg entwickelt entlang der Solidaritätslinien Ideen zu einer strategischen Identitätspolitik. Ich schätze, daran führt kein Weg vorbei. Wir müssen das „Wir“ erweitern.