


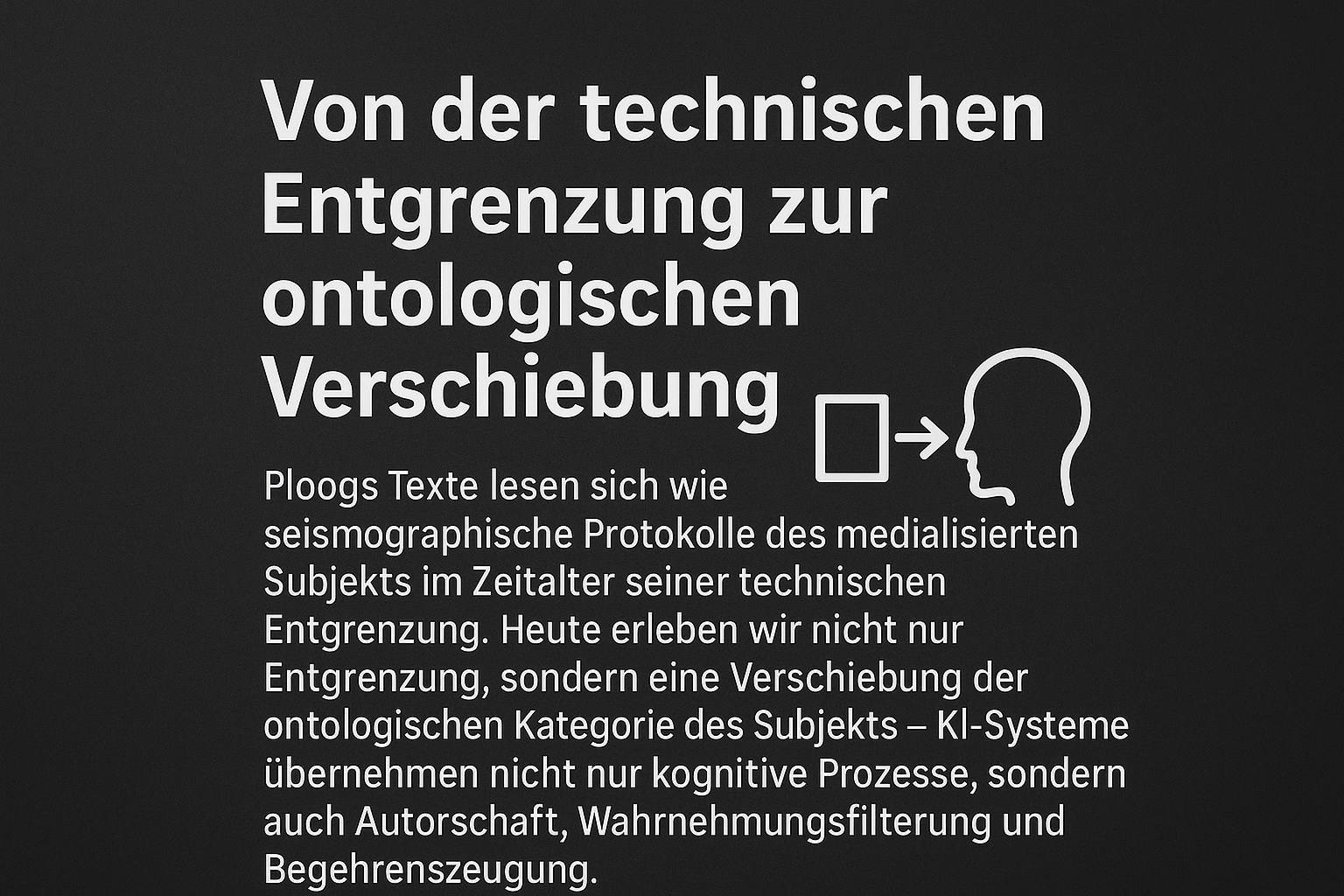
Von der technischen Entgrenzung zur ontologischen Verschiebung
Von Walter Benjamins „technischer Reproduzierbarkeit“ über Jürgen Ploogs technischer Entgrenzung zu …
Heute erleben wir nicht nur Entgrenzung, sondern eine Verschiebung der ontologischen Kategorie des Subjekts – KI-Systeme übernehmen nicht nur kognitive Prozesse, sondern auch Autorschaft, Wahrnehmungsfilterung und Begehrenserzeugung.
Ploog könnte hier als literarischer Vorläufer eines menschlich-maschinellen Post-Subjekts gelesen werden.
Ploogs neuronale Perspektive als Vorwegnahme heutiger Diskurse
Ploog exponiert eine Unterscheidung zwischen der neuronal-funktionellen und der psychologischen Seite des Gehirns. Das lässt sich noch stärker mit aktuellen Debatten verbinden. Neurowissenschaft und KI-Forschung diskutieren intensiv die Frage, ob Bewusstsein emergent aus neuronaler Aktivität entsteht oder ob es eine andere Dimension braucht. Ploogs Blick antizipiert damit die Spannung zwischen Simulation (maschinelles Lernen) und Phänomenalität (qualia). Sein literarisches Verfahren könnte man als eine Art „ästhetisches Brain Mapping“ sehen - eine poetische Simulation neuronaler Prozesse.
Poetische Kybernetik als Gegenentwurf zur Dystopie
Viele heutige KI-Narrative sind dystopisch oder technikpessimistisch. Ploogs Ansatz ist affirmativ: Technik als Erweiterung statt Bedrohung des Subjekts. Verschmelzung nicht als Kontrollverlust, sondern als poetische Öffnung. Das könnte man als „kybernetische Utopie im Modus der Avantgarde“ fassen.
Ploogs literarische Verfahren funktionieren wie neuronale Netzwerke avant la lettre – fragmentarisch, assoziativ, rückgekoppelt. Sie simulieren eine Form des Denkens, die nicht linear, sondern moduliert, verschaltet, gefaltet ist. In dieser Perspektive ist Ploogs Werk nicht nur Kommentar, sondern selbst ein Prototyp kybernetischer Literatur. In einer Zeit, in der Large Language Models Texte generieren, die wie menschliche klingen, gewinnt diese poetische Simulation des neuronalen Denkens eine zweite Gegenwart.