


So weit kommt es, dass Adorno einer Betrachtung eine Zeile von Friedrich Stoltze voranstellt:
„Ui, haww‘ ich gesacht.“
Stoltze kennt man auch deshalb: „Es is kaa Stadt uff der weite Welt, die so merr wie mei Frankfort gefällt, un es will merr net in mein Kopp enei, wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei.“
So zeigt Adorno, beinah beschämt, wie lieb ihm die Perle am Main ist. Bellevue hieß die Frankfurter Anschrift seiner Kindheit. Er stellt Hegel zu Hölderlin: „Wie in der Hegelschen Spekulation wird unterm Blick des Hölderlin‘schen Gedichts das geschichtlich Endliche zur Erscheinung des Absoluten.“
Hölderlin habe den Betrieb der Welt als Konferenzschaltung begriffen und überall „Korrespondenzen“ gesehen. Wieder bringt Adorno Hölderlin in Anschlag, um auf Heidegger anzulegen, der „ohne Organ für die kollektive Kraft (sei), welche geistige Individuation überhaupt erst hervorbringt.“
Adorno zieht ein demoliertes Weltvertrauen aus dem Klang. Sein Verhältnis zu Bloch bestimmt die Namensaura nicht zuletzt. „Dunkel wie ein Tor, gedämpft dröhnend wie ein Posaunenstoß“ - das gestattet sich Adorno, um eine Zuneigung deutlich zu machen. Er rückt „Das Prinzip Hoffnung“, das noch in meiner Generation wie ein Aphrodisiakum wirken sollte, in die Nähe jener Versprechen, die ihm „schweinsledern“ gebundene „mittelalterliche Bücher“ machten, solange er als Kind das magische Nostradamuswissen in verstaubten Wohnungswinkeln vermutete.
Bloch verhilft Adorno zu dem Gefühl, „hier sei die Philosophie dem Fluch des Offiziellen entronnen“.
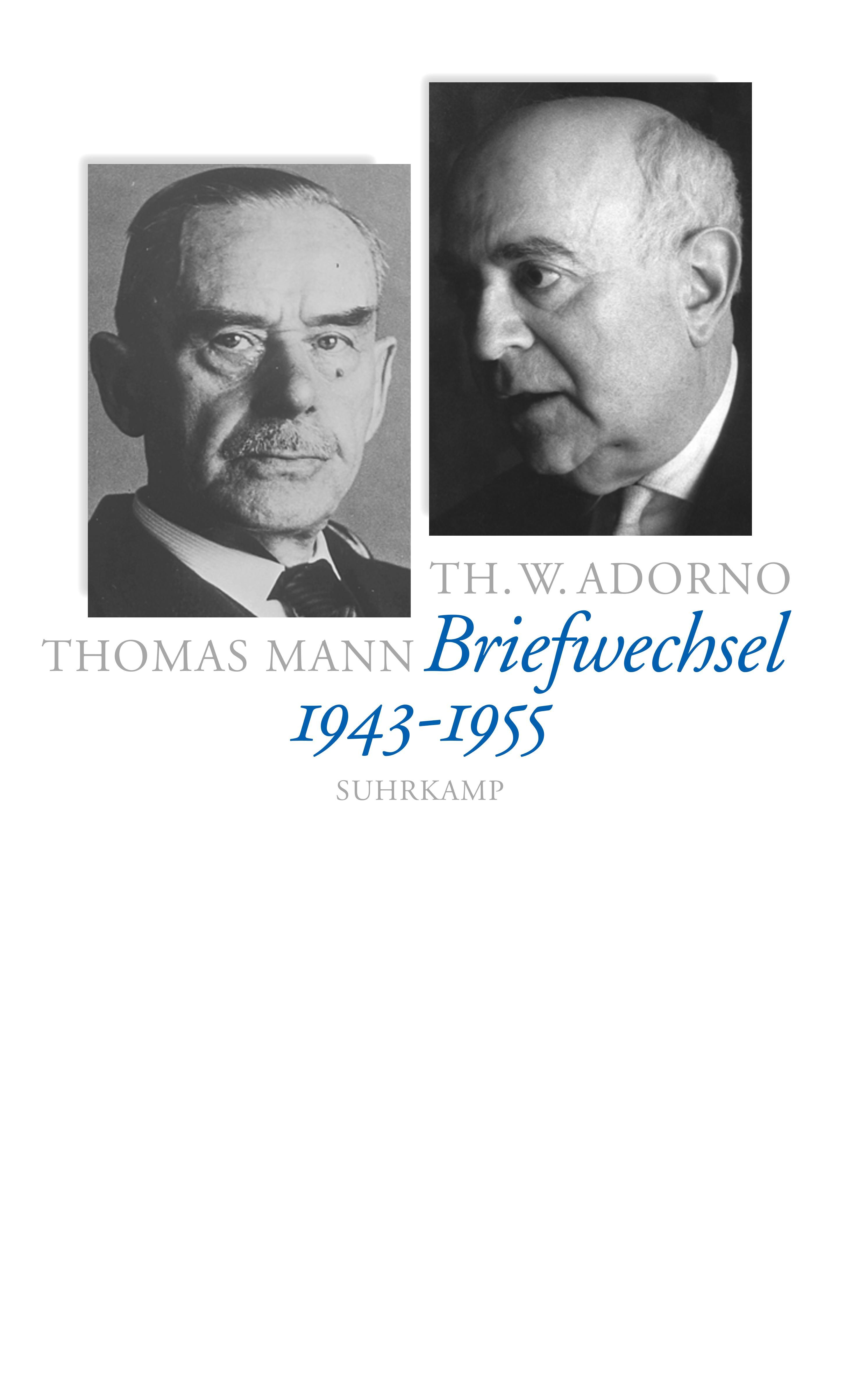
Adorno schildert Ernst Jünger als „elend schlechten, verkitschten Schriftsteller … (und) second hand-George“. Der Kritiker sagt dem Autor eine „kurzfristige Unsterblichkeit voraus“.
*
In einem Brief an Thomas Mann vom 28. Dezember 1949, Adorno hält sich in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main auf und wohnt bei Irmer in der Liebigstraße, konstatiert er die „ins Wesenlose zerrinne“ deutsche Schuld. Der Vorgang wiederhole sich bis zum Stadium des Unscheinbaren. Die Verdrängung gelinge wundersamerweise. Adorno berichtet, dass er sich gezwungen gesehen habe, einen Schüler „an Auschwitz erinnern“, da jener „treuherzig“ damit aufwartete, die Deutschen hätten „den Antisemitismus nie ernstgenommen“.
Niemand will etwas gewusst haben.
Nun sagt Adorno: „Dass das Geschehene aller zureichenden Erfahrung entrückt ist, hat auch noch die paradoxe Wirkung, dass man es kaum realisiert.“
Auch Adorno selbst bedarf der Selbstermahnung, um nicht einfach außer Acht zu lassen, „dass der Nachbar in der Tram ein Henker gewesen sein kann“.
Adorno beschreibt bereits Ende der 1940er Jahre, was seither das Gedächtnistheater als einer deutschen Veranstaltung bestimmt. „Eigentümlich amorph“ seien die Darstellungen der in Nürnberg vor Gericht gestellten Täter:innen. Der wahnsinnig machende Irrsinn fände da seinen „drastischsten Ausdruck: Ich habe, außer ein paar rührend marionettenhaften Schurken von altem Schrot und Korn, noch keinen Nazi gesehen“; nicht nur nicht in einem ironischen Sinn, „sondern in dem weit unheimlicheren, dass sie glauben, es nicht gewesen zu sein“.
Theodor W. Adorno/Thomas Mann, Briefwechsel 1943–1955, Suhrkamp
Adorno bemerkt dann etwas, dass für die geschlagenen Täter:innen wie ein Rettungsseil funktioniert hätte, wäre sie denn imstande gewesen, zu den Quellen vorzudringen. Sie könnten es spekulativ „insofern wirklich nicht (gewesen sein), als angesichts des dem Menschen entfremdeten Unwesens der Diktatur diese nie … zugeeignet wurde wie ein bürgerliches System, sondern fremd … als eine böse Chance und Hoffnung außerhalb der Identifikation blieb“.
Zum Glück geriet das exkulpierende Argument nicht in die Schulddiskussion, zumal man leicht daran zweifeln kann, dass Bürgerlichkeit einen staatsverbrecherischen Antrieb ausschließt. Außerdem spricht Adorno an anderer Stelle von jener Kultur, die den Holocaust gebar.